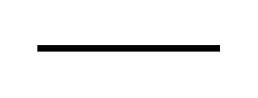MISSY MAGAZINE | Jun 5,2018 | DE
Interview: Jesse R. Buendia
Wieso hast du dich gerade jetzt dazu entschieden, ein Album zu veröffentlichen?
Electric Indigo: Zu einer ernst zu nehmenden Musikerin gehört auch ein Album. Es war schon längst überfällig und ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Ich finde auch das Format Album mit einer Dauer von einer Stunde interessanter, um in meine Soundwelt einzutauchen, weil sie schon speziell ist.
Wie ist die Arbeit zum Album verlaufen und was waren deine Inspirationen?
Die Inspiration ist das Ergebnis meiner Arbeit der letzten sechs Jahre. Es gibt ein paar Schlüsselwerke, wie z. B. „Chiffres“, das 2012 bei Wien Modern uraufgeführt wurde. Die klangliche Grundlage von „Chiffres“ waren Aufnahmen, in denen Leute in ihrer Muttersprache von null bis zwanzig zählen. Aus diesen Zahlen habe ich im Laufe des Stücks in immer größeren Abstraktionen das klangliche Material erzeugt. Am Anfang versteht man noch sehr gut, was gezählt wird, und am Ende bis 15 ist es nicht mehr erkennbar. Ganz klar ist es bei „Trois“, das ein Derivat von „Chiffres“ ist. Es gibt auf dem Album gemeinsame Grundlagen, weswegen es für mich ein kohärentes Album ist. Bei vielen Tracks sind die meisten Sounds aus gesprochener Sprache generiert. Bei „Trois“ sind also sehr viele Aufnahmen von Freundinnen und Freunden in dem Stück gelandet. Beim Arbeiten hatte ich das Gefühl, als wäre ich von meinen Freunden und Freundinnen umgeben gewesen. Wenn jemand zählt, hat das normalerweise keine emotionale Aussage, aber durch die Intonation und durch die Stimmen ist das so individuell. Dadurch wird schon beim Zählen so viel Persönlichkeit vermittelt, dass ich immer ein konkretes Bild von den Leuten in meinem Kopf hatte.
Wie fühlst du dich nach deinem Albumrelease?
Ich bin total überrascht, dass es so viele positive Rückmeldungen gibt, weil es nicht leicht zugänglich ist und die Leute zwar erkennen, dass es gut klingt, aber nichts damit anfangen können. Doch es geht nicht allen so und das freut mich sehr, weil das auch ein Grund war, weshalb es so lange gedauert hat, ein Album rauszubringen. Den letzten Anstoß gab mir mein Label, das Vertrauen in mir gesetzt hat.
Du bist schon lange Teil der Technoszene. Was hat sich für dich in den letzten 25 Jahren verändert? Was ist für dich besser geworden und was vielleicht auch schlechter?
Schlechter würde ich eigentlich gar nicht sagen. Was sich verändert hat, ist unsere Form der Kommunikation und der Informationsaustausch. Z. B. Plattenkauf in den 1990ern. In Wien hätte ich die Platten, die ich gerne gespielt habe, nie bekommen. Dafür musste ich nach München oder sogar besser nach Berlin fahren und dort zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Plattenladen stehen und Glück haben, eine von den wenigen Kopien zu bekommen. Heute ist es eine ganz andere Situation, weil man alles unmittelbar verfügbar hat als digitale Datei. Es ist einfacher geworden, sich mit Musik zu beschäftigen. Auch in Ländern, in denen Warenlieferungen schwierig sind, können die Leute sich mit Techno beschäftigen und DJs oder Produzent*innen werden, weil die Informationen verfügbar sind. Natürlich setzt auch dies eine gewisse Infrastruktur voraus. Ähnliches trifft auf die Produktionsmethode zu. Das ist viel billiger geworden als damals in den 1980ern. Nun können es viele Leute machen. Auch wenn die Kehrseite sein mag, dass viel generisches und unoriginelles Zeug rauskommt und sehr viel Masse da ist. Aber das nehme ich gerne in Kauf, weil das für mich auch ein Grund ist, weshalb viel mehr Frauen Musik machen, was mit der Verfügbarkeit der Produktionsmittel zusammenhängt. Es gibt auch negative Auswüchse, was die Kommerzialisierung betrifft, aber Kommerz gab es auch vor dreißig Jahren, das ist kein neues Phänomen.
Würdest du sagen, dass aufgrund der Digitalisierung von Musik auch deine Sets und dein Musikstil beeinflusst wurden?
Nein, nicht wirklich. Es ist der technische Rahmen, der sich verändert hat, aber nicht der inhaltliche. Meine Art des Auflegens hat sich natürlich verändert, weil ich keinen Platz mehr für Platten in meiner Wohnung habe. Deswegen bin ich froh, dass ich das meiste als nicht physische Musik zur Verfügung habe. Heutzutage bekommt man auch digitale Promos, was ich schlauer finde als die Materialverschwendung. Früher hat man Platten bekommen, aber wie das so ist, hört man fünf Prozent gerne und 95 Prozent fallen weg, was eine große Ressourcenverschwendung ist. Nicht nur bezogen auf Porto, sondern auch wegen dem Vinyl. Für Plattenläden ist es dadurch natürlich immer schwieriger geworden. Aber einen Plattenladen zu führen war immer ein finanzielles und wirtschaftliches Risiko. Du musst es dir leisten können, einen Backstock anzulegen und vorausschauend zu denken. Das kann man nur, wenn man genug Geld hat, weil dann da für zehn Jahre der Stock steht und das Geld ist an den Platten gebunden.
Wie ist deine Wahrnehmung von Veränderungen bezogen auf female:pressure? Gab es Veränderungen?
Es gab eine eklatante Veränderung. Die Eklatanteste ist auf jeden Fall, dass jetzt alle E-Mail-Adressen haben (lacht). Es gibt auch eine klare steigende Tendenz an Frauen, die Musik produzieren. Am Anfang waren es mehr DJs und weniger Produzent*innen, das hat sich geändert. Die Leute bringen mehr Musik raus, weil dies auch eine Hürde war oder eine Hürde ist. Du kannst zwar Musik machen, aber du musst trotzdem ein Label finden, das deine Musik veröffentlicht oder selbst eins gründen.
Ihr habt 2013 die erste Analyse über die Geschlechterverhältnisse in Festival-Line-ups veröffentlicht. Wie waren die Reaktionen? Hast du das Gefühl, dass Veranstalter*innen und Besucher*innen die Augen geöffnet wurden?
Absolut. Das ist wie eine Bombe eingeschlagen. Nach wie vor wird diese erste Umfrage zitiert. Wir waren die Ersten, die das im elektronischen Musikbereich gemacht haben. Medial ist das gut aufgegriffen worden und schlägt nach wie vor Wellen. Geschlechtergerechtigkeit im Bereich Clubkultur und elektronischer Musik ist dadurch ein hippes Thema geworden. Ursprünglich wurden wir durch #aufschrei motiviert. Wir haben eine interne Mailingliste, auf der eigentlich alle Projekte initiiert werden, und Gudrun Gut hat geschrieben, ob wir als female:pressure reagieren sollen. So ist aus der Sexismusdebatte, die wir auf der Mailingliste führten, eine „Spielen genug Frauen auf Festivals?“-Debatte geworden. Diese Wellen, wie auch aktuell #metoo oder #timesup, spielen uns natürlich in die Hand und sie scheinen nicht komplett abzureißen, obwohl ich im Laufe der letzten Jahrzehnte schon eine Beobachtung mache. Es werden, und das werden auch Feminist*innen der alten Schule sage, immer wieder die gleichen Diskussionen geführt. Mal ist es hipper, mal wird es verbannt, mal stehen junge Frauen dahinter und mal müssen sie sich davon distanzieren. Es geht in Wellen und man kommt nur extrem langsam voran. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir mit den Frauenrechten in den späten 1970er-Jahren vielleicht schon weiter waren. Bei aller „Hipness“ darf man nicht vergessen, wie mächtig der gesellschaftliche Bereich ist, wo Feminismus kein Schmuck ist.
Eben weil es ein hippes Thema ist, glaubst du, dass bei Veranstalter*innen ein Konsens vorhanden ist? Also dass weibliche DJs gebucht werden, weil sie gut sind, oder spielt Tokenism auch eine Rolle?
Es gibt alles. Diese Tokenism-Geschichte hat es schon immer gegeben, also dass man eine Frau bucht, weil es peinlich ist, wenn gar keine da ist, falls man vielleicht doch drauf angesprochen wurde. Das habe ich auch immer wieder in meiner Karriere bemerkt. Jetzt ist es etwas dringlicher geworden. Es kommt darauf an, wo man hinschaut. In Berlin ist es peinlich, wenn du als Veranstalter*in ein ausschließlich männliches Line-up hast. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in weniger progressiven Orten überhaupt kein Thema ist, wenn das komplette Line-up männlich ist. Tokenism gibt es auf jeden Fall. Es gibt das Phänomen, dass Frauen gebucht werden, weil man jetzt Frauen buchen muss, das ist aber vielleicht ein bisschen anders als Tokenism, weil es mehr als eine ist. Es gibt ein allgemeines Diversity-Phänomen.